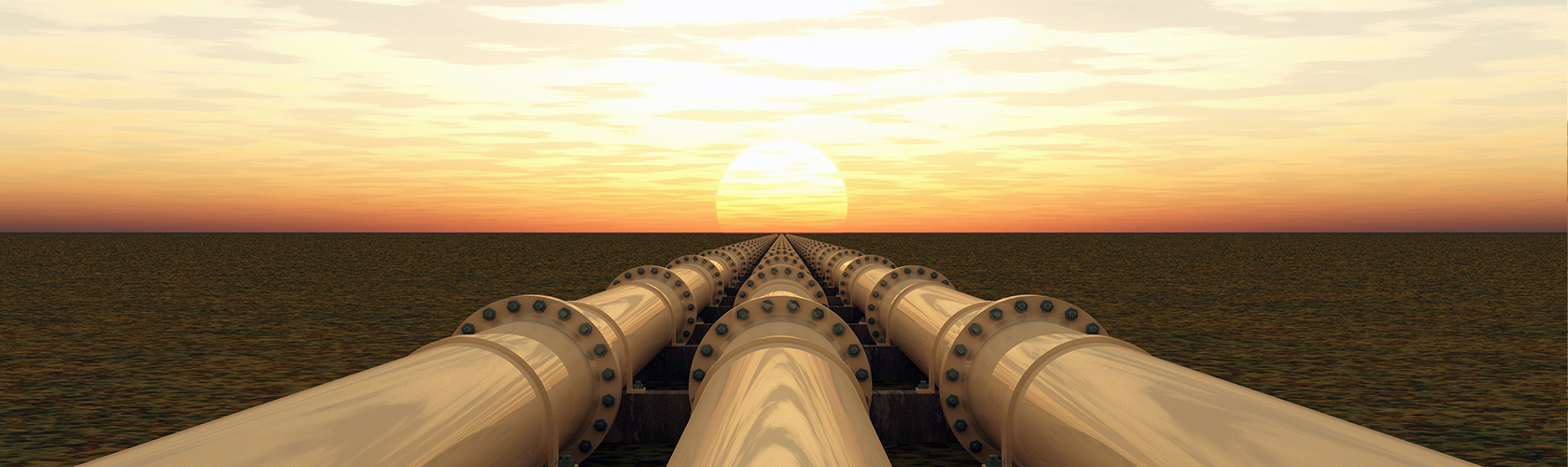Wie der Ukraine-Krieg die Energiemärkte auf den Kopf stellt
Der russische Einmarsch in die Ukraine hat die Energiemärkte auf den Kopf gestellt. Jahrelange Gewissheiten wurden obsolet, die Zukunft präsentiert sich offener denn je. StromLinie zeichnet Chancen und Herausforderungen nach, die nun auf die Branche zukommen. Eine erste Einordnung.
Es sind Wochen, die die Welt verändern. Russische Raketen zerstören ukrainische Städte, Millionen Menschen sind auf der Flucht, die Gefahr einer weiteren militärischen Eskalation schwebt über Europa. Dabei wollte noch zu Jahresanfang kaum jemand an eine groß angelegte russische Invasion in der Ukraine glauben. Die große energiepolitische Diskussion konzentrierte sich damals auf die Frage: Wie lassen sich die kräftig anziehenden Energiepreise in den Griff bekommen?
Am 24. Februar ist mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine aus der Preisfrage auf einen Schlag eine Verfügbarkeitsfrage geworden. Wie lange russisches Gas noch durch die Ukraine fließen wird, vermag seitdem niemand zu sagen. Der Ausstieg aus dem Erdgas wurde auf einmal aber auch zu einer moralischen Entscheidung, Europa musste sich die Frage stellen: Wie lange noch wollen wir mit unseren
Devisen Putins Russland unterstützen?
Erschüttert hat der Einmarsch in die Ukraine auch das lange gehegte Vertrauen in eine Welt, in der Konflikte auf zivilem Weg gelöst werden und wirtschaftlicher Austausch den Frieden garantiert. Die Formel, mit Gaskäufen Russland zu demokratisieren, gilt spätestens seit dem 24. Februar nicht mehr. So sie je gegolten hat. Doch was meint all das konkret?

Was bedeutet der Ukraine-Krieg für die globale Energieversorgung?
Und: Wie hängt russisches Erdgas mit der österreichischen Stromproduktion zusammen?

Mit seinen tausenden zivilen Toten hat der Krieg, unabhängig davon, wie er ausgehen wird, schon heute die geostrategische und erst recht die energiepolitische Weltkarte verändert. Europa und die Vereinigten Staaten rücken so nahe zusammen wie schon lange nicht mehr. Auf der anderen Seite steht ein russisch-chinesisches Bündnis im Raum. Und auch die arabische Welt bringt sich in Stellung.
„Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate spielen jetzt ihre Macht dem Westen gegenüber aus, weil sie wissen, dass der Westen sie als Energielieferanten dringender braucht denn je. Vor allem für Europa kann das zu einem Problem werden. Denn Europa ist nicht so energieautonom wie die USA“, urteilt Kristina Spohr, Geopolitik-Spezialistin und Professorin an der London School of Economics.
Russland braucht China
Zugleich wende sich Russland verstärkt China zu. „China ist ein Großabnehmer russischer Energie und Rohstoffe und ein guter Investor“, sagt Spohr. „Andererseits ist eine zu enge Bindung an China aus russischer Sicht problematisch, weil China geopolitisch ein Konkurrent ist. China will bis 2050 eine führende Macht in der Welt werden, aber Russland will nicht Chinas Vasall sein.“ Und schließlich, ergänzt die Professorin, seien da auch noch die völlig unterschiedlichen kulturellen Zugänge. Moskau sei eben in Europa, Peking in Asien.
Trotzdem: Im Moment braucht Russland China. Selbst wenn die beidseitigen Dementi, wonach Moskau Peking niemals um militärische Unterstützung in der Ukraine gebeten hat, stimmen – ökonomisch ist der russische Präsident auf das Wohlwollen Chinas angewiesen. Auch und gerade im Energiesektor. Denn was in der breiteren Öffentlichkeit vielfach unbemerkt blieb: Fast sofort nach dem Beginn des Krieges gaben die Preise für russische Energieträger nach.

Preisverfall bei russischem Erdöl
Während Erdöl der Nordseesorte Brent zwischenzeitlich auf den Höchststand von 118 Dollar kletterte, stürzte russisches Öl der Marke Urals regelrecht ab. Seitdem ist die Differenz zwischen Brent und Urals so groß wie noch nie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Mitte März betrug sie fast 30 Dollar pro Barrel – ein deutliches Zeichen, dass nicht nur die USA, die mittlerweile ein Embargo auf russische Energie verhängt hatten, sondern auch andere westliche Player Einkäufe in Russland einstellten. Täte es auch China, hätte Wladimir Putin ein ziemliches Problem, seinen Ukraine-Feldzug zu finanzieren. Mehr noch: Er müsste auch die Sozialtransfers an jene breiten Schichten der verarmten russischen Bevölkerung kappen, deren passive Unterstützung ihm neben dem Militär- und Geheimdienstapparat die Macht sichert.
Für den Westen ist es in dieser Situation freilich umso wichtiger, Alternativen zum russischen Erdgas zu schaffen. 1600 TWh Gas pro Jahr hat Europa zuletzt über diesen Energieträger aus Russland bezogen. In Österreich werden 80 Prozent des Erdgasbedarfs von Russland gedeckt. Die Elektrizitätswirtschaft ist nach der Industrie der zweitgrößte Abnehmer davon. Denn vor allem im Winter reichen Wind-, Wasser- und Sonnenkraft allein nicht aus, um die benötigten Strommengen zu produzieren. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Nach vollzogener Energiewende soll allerdings auch jenes Gas, das nötig ist, um die Stromversorgung zu sichern, aus erneuerbaren Quellen stammen.
LNG als Alternative?
Noch ist es aber nicht so weit. Weshalb als Zwischenlösung immer wieder LNG ins Spiel gebracht wird. „LNG kann als Übergangslösung helfen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Das ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden, dem Bau von Terminals und Pipelines – das geht nicht von heute auf morgen“, kommentiert Karina Knaus, Leiterin der Ökonomie-Abteilung bei der Österreichischen Energieagentur. Neben Ländern des Nahen Ostens, Stichwort: Katar, die zuletzt vor allem von der Politik als mögliche Lieferanten von LNG ins Spiel gebracht wurden, wäre grundsätzlich auch Norwegen ein interessanter Partner. Bei näherer Betrachtung erweist sich allerdings auch die norwegische Option als schwierig.
Nach Russland ist Norwegen der zweitgrößte Erdölproduzent Europas, wobei das Land pro Tag rund vier Millionen Barrel Erdöläquivalente fördert, die Hälfte davon als Erdgas. Um den europäischen Markt mit LNG zu versorgen, wäre vor allem eine Steigerung des Erdgasanteils wichtig, da sich Erdgas technisch relativ einfach zu LNG verflüssigen lässt. Norwegische Ölfelder sind allerdings meist darauf ausgelegt, parallel Öl und Gas zu fördern, wobei sich das Verhältnis der beiden Bestandteile nicht ohne Weiteres verändern lässt. Zahlreiche norwegische Erdgasvorkommen sind außerdem noch überhaupt nicht erschlossen. Das zu tun, würde Zeit ebenso brauchen wie umfangreiche Investitionen. Aus der Ad-hoc-Perspektive betrachtet, mangelt es sowohl der Katar- als auch der Norwegenoption aber vor allem an Transportmöglichkeiten: Die bestehenden Pipelines sind ebenso ausgelastet wie die meisten LNG-Terminals in der EU.
Wie kann sich Europa aus der Abhängigkeit von Russland befreien?
Und: Werden die Energiepreise dann noch weiter steigen?

Russlands Invasion in der Ukraine war in ihrem aktuellen Ausmaß tatsächlich schwer vorherzusehen, auch wenn einige Nato-Partner wie Polen oder die baltischen Staaten immer wieder vor exakt diesem Szenario warnten. Dafür, dass Russland vorhat, seine Politik dem Westen gegenüber zu verschärfen, gab es hingegen jede Menge Anzeichen. Dennoch traf die Erdgas-Krise Europa unvorbereitet.
Dabei konnten aufmerksame Beobachter schon im Oktober des Vorjahres ein geändertes Marktverhalten des russischen Erdgasriesen Gazprom feststellen. Ab 2018 bot Gazprom neben Lieferungen, die in Verträgen langfristig vereinbart sind, auch die Möglichkeit, Erdgas auf kurzfristiger Basis über eine eigene Online-Plattform zu kaufen. Seit Oktober 2021 ist es damit vorbei. Seitdem hat Moskau an den Westen nicht einen Kubikmeter Gas mehr geliefert, als es nötig ist, um die bestehenden Verträge zu erfüllen.
Preis-Rallye
Der Gaspreis bekam dadurch einen Schub nach oben. Die Preis-Rallye, die im Herbst begann, hatte aber auch andere Gründe. Einer davon war im Prinzip positiv: Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie erholte sich die globale Wirtschaft schneller als gedacht und brauchte dementsprechend mehr Energie. Einige andere Ursachen waren indessen weniger erfreulich: vor allem der niedrige Speicherstand ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Preise massiv nach oben zu klettern begannen.
„Die Speicherstände waren niedrig und wurden auch kaum gefüllt“, erklärt Karina Knaus die Entwicklung. „Der Grund dafür lag unter anderem darin, dass gerade die hohen Preise keinen Anreiz zum Einspeichern gaben. Denn die Betreiber der Speicher konnten nicht sicher sein, dass sich der Gaspreis auch im Winter und den Folgemonaten noch auf einem so hohen Niveau befinden würde und sie das Gas ohne Verlust wiederverkaufen könnten.“
Bei gerade einmal 98 lag der österreichische Gaspreisindex im Juni 2021, im Oktober schon bei 217, im Dezember bei 365 und im März 2022 bei 442, wobei da die Effekte des Ukraine-Kriegs noch kaum berücksichtigt sind.
Die Entwicklung beim Strompreis war ähnlich, auch wenn die Kurve nicht ganz so steil nach oben ging. „Über die Gaskraftwerke, die in der kalten Jahreszeit verstärkt laufen, wirken sich Preissteigerungen bei Gas auch auf die Strompreise aus“, erklärt Michael Strebl, Geschäftsführer der Wien-Energie und Spartensprecher Handel und Vertrieb bei Oesterreichs Energie.

Preistreiber Gas
Der zuverlässigste Weg, sich sowohl aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien, als auch von den hohen Strompreisen loszukommen, wäre daher ein möglichst schneller und vollständiger Ausstieg aus der fossilen Energie. Das bestätigt auch die Wirtschafts- und Energieexpertin Karina Knaus. Auch wenn Gegner der erneuerbaren Energie gern von einer „Greenflation“ reden würden und damit unterstellen, dass der Umstieg auf nicht fossile Energieträger die Strompreise in die Höhe treibe, sei es in Wirklichkeit gerade umgekehrt. Richtigerweise müsste man daher von einer „Fossilflation“ sprechen: „Es sind die im Winter nach wie vor notwendigen Gaskraftwerke mit ihren hohen Grenzkosten, die den Preis in die Höhe treiben.“
Das tun sie tatsächlich. Denn selbst die Verstromung von Kohle oder die Produktion von Strom aus Kernenergie erweisen sich in ihren Grenzkosten niedriger als Strom aus Erdgas. Dass Kohle keine nachhaltige Option darstellt, ist allerdings offensichtlich – auch wenn der grüne deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck kürzlich angesichts des Ukraine-Kriegs von der Möglichkeit gesprochen hat, den Kohleausstieg zu verzögern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Last Exit Kernkraft?
Bei Kernkraft fällt das Urteil nicht ganz so eindeutig aus. In den entsprechenden Zusätzen zur EU-Taxonomie-Verordnung, die für eine nachhaltige europäische Ökonomie sorgen soll, wird Kernkraft zumindest als potenziell nachhaltig eigestuft. Atomkraftwerke haben außerdem den Vorteil, verhältnismäßig billig im Betrieb zu sein und keinen CO2-Ausstoß zu verursachen.
„Kernenergie ist in ihren Grenzkosten relativ günstig, allerdings ist sie mit einem schweren und schwer beherrschbaren Sicherheitsrisiko verbunden“, kommentiert Karina Knaus. „Dazu kommt, dass AKWs eine über den gesamten Lebenszyklus gerechnet sehr teure Technologie sind. Für Kernkraft kann man da Kosten von dreizehn bis zwanzig Cent pro KWh annehmen, bei den Erneuerbaren sind es nur vier bis acht Cent pro KWh. Kernkraft ist auch eine Technik, die im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien eine negative Lernkurve hat: Sie wird, je länger es sie gibt, in ihrer Errichtung immer teurer.“
Womit klar wird: Im Grunde muss der Weg zu einer unabhängigen europäischen Stromversorgung unabhängig von der aktuellen Krise über die erneuerbaren Energien führen. Gerade im privaten Bereich erwarten Experten von der Krise aber auch den einen oder anderen positiven Impuls, da es aufgrund der hohen Preise nun auch für Privathaushalte ökonomisch notwendig wird, den eigenen Energiekonsum zu hinterfragen: „Es ist also tatsächlich ein günstiger Zeitpunkt, um Effizienzpotenziale im eigenen Umfeld zu identifizieren und, wo möglich, zu heben. Dabei denke ich weniger an kleinere Verhaltensänderungen, sondern vor allem an strukturelle Maßnahmen in den Bereichen Wohnen und Mobilität“, sagt Wien-Energie Chef und Spartensprecher Handel und Vertrieb von Oesterreichs Energie Michael Strebl. „Denn den kleinsten Preis und den kleinsten ökologischen Fußabdruck haben am Ende die Kilowattstunden, die gar nicht verbraucht werden.“

Worauf müssen sich Kunden und ihre Lieferanten in den nächsten Monaten einstellen?
Und: Wie lassen sich die sozialen Folgen abfedern?

Bei allem Optimismus ist für die nächsten Monate aber auch klar: Sowohl für Kunden als auch für Lieferanten wird die Marktsituation schwierig bleiben. Die Energielieferanten werden nicht umhin kommen, ihre Preise weiter anzupassen, die Kunden werden mit zum Teil empfindlichen Tariferhöhungen zu Rande kommen müssen. Um 455 Prozent ist der Gaspreis im März 2022 höher gewesen als im März 2021, der Strompreis um 139 Prozent.
Selbst bei einer maßvollen Preisanpassung bedeuten diese Werte vor allem für niedrige Einkommen eine massive Belastung. Das weiß auch Michael Strebl und er erklärt: „Die Energieunternehmen haben deshalb eine Reihe von freiwilligen Maßnahmen gesetzt, darunter die Verdoppelung der Mittel zur Bekämpfung von Energiearmut und ein Verzicht auf Strom- und Gasabschaltungen für soziale Härtefälle bis Ende Mai 2022.“ Zudem verweist er auch auf die Maßnahmen der Bundesregierung, die er als einen ersten guten Ansatz bezeichnet.
Akute Hilfe dringend nötig
Das sieht auch Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich, so, schränkt aber ein, dass mit dem neuerlichen Preisschub nun dringend neue und vor allem auch schnell wirkende Maßnahmen nötig seien: „Der Energiekostenausgleich ist keine akute Hilfe. Diese Ausgleichszahlung soll über die Energieversorger erst bei der nächsten Jahresstromabrechnung in Abzug gebracht werden, die Reduzierung kommt also erst in dem Monat, in dem man seinen Vertrag abgeschlossen hat. Das kann jetzt sein, aber auch erst im August oder Dezember.“
Dass die Lage dramatisch sei, sehe die Caritas tagtäglich in ihren Beratungsstellen: „Wir haben einen massiven Zustrom von Menschen, die noch vor zwei Jahren nicht im schlimmsten Traum daran gedacht hätten, dass sie die Leistungen der Caritas in Anspruch nehmen werden. Da muss ganz dringend etwas passieren, sonst werden sich diese Menschen im kommenden Winter die Heizkosten nicht mehr leisten können.“
Doch was soll passieren? Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, wie der Ökonom Stephan Schulmeister, bis zu seiner Pensionierung 2012 am Wifo tätig, ausführt. In der Energiepolitik stehe man im Moment vor zwei Fragen. Einerseits: Wie lässt sich die Energieversorgung so gestalten, dass fossile Energieträger zurückgedrängt werden? Andererseits: Wie kann man die steigenden Energiepreise so abfedern, dass sie die niedrigen Einkommen nicht überproportional treffen?
Gegen das Gießkannenprinzip
„Das sind zwei verschiedene Ziele, die man nicht sinnvoll mit einer Maßnahme erreichen kann“, sagt Schulmeister. „Ein Preisdeckel, die Senkung der Mehrwertsteuer, das Aussetzen der CO2-Bepreisung, kurz: Alle Maßnahmen, die Energie für jeden bezuschussen, sind nicht treffsicher, weil sie auch jene entlasten, die höhere Energiepreise verkraften können.“ Auch klimapolitisch seien solche Eingriffe nicht sinnvoll, weil Haushalte mit mittleren und höheren Einkommen und Unternehmen dann erst recht wieder weniger Anreiz haben würden, ihren CO2-Verbrauch zu reduzieren.
Wenn es darum gehe, niedrige Einkommen vor den Folgen hoher Energiekosten zu schützen, ohne zugleich fossile Energie zu subventionieren, wäre es daher sinnvoller, findet Schulmeister, niedrige Einkommen generell zu entlasten: im Niedriglohnsektor durch eine Negativsteuer, bei Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern und Mindestsicherungsbeziehern durch Erhöhung dieser Leistungen.
Und wolle man die Unterstützung unbedingt auf den Energiesektor beschränken, dann gebe es immer noch die Möglichkeiten von gestaffelten Stromtarifen. „Je nachdem, wie viele Personen ein Haushalt hat, lässt sich errechnen, wie viel Energie dieser Haushalt für die Deckung seiner Energie-Grundbedürfnisse benötigt wie Heizen oder Kochen. Bis zu dieser Verbrauchsmenge könnte es einen günstigen Tarif geben, darüber einen teuren. Wer seinen Swimmingpool befüllen und aufheizen will, der kann ruhig dafür auch mehr zahlen.“

Kann der Markt alles lösen …
Doch auch beim Versuch, ökonomischen Druck für den Ausstieg aus der fossilen Energie aufzubauen, würde Schulmeister auf andere Modelle setzen als jene, die im Moment eingeführt werden. Denn, so sagt er, eine CO2-Bepreisung als Versuch, von Erdöl und Erdgas wegzukommen, habe den Nachteil, dass sie vom Markt abhängig bleibe. Im Moment, wo die Energiepreise hoch seien, wäre der Anreiz zu einem Umstieg gegeben. Sinke der Preis, verpuffe die Wirkung aber: „Gehen die Preise herunter, zahlt sich trotz CO2-Bepreisung der Umstieg auf erneuerbare Energie für viele nicht aus.“
Und sinkende Erdölpreise seien in Zukunft durchaus möglich, meint Schulmeister, auch wenn das im Moment für viele unvorstellbar scheine. „Wir hatten in den letzten zwanzig Jahren drei Peaks mit Erdöl-Preisen nahe oder über der 100-Dollar-Grenze pro Barrel und die Preise fielen dann doch immer wieder auf rund 30 Dollar oder noch weniger. Es ist nicht ausgemacht, dass das nach der aktuellen Krise nicht auch wieder passiert“, sagt Schulmeister.
… oder ist die Zeit staatlicher Maßnahmen gekommen?
Das Ausstiegsszenario, für das er sich einsetzt, versucht daher die Energiepreise vom Erdölpreis am Weltmarkt abzukoppeln. „Es wäre sinnvoll, einen fixen Preispfad für Öl, Gas und Kohle vorzugeben, mit moderaten Steigerungen von zum Beispiel fünf Prozent von Jahr zu Jahr. So könnte sich jeder Unternehmer und jeder Haushalt ausrechnen, ab wann sich fossile Energie für ihn nicht mehr lohnt und auf diese Weise sichere und langfristige Investitionsentscheidungen treffen.“
Den Unterschied zwischen dem Weltmarktpreis und dem Preispfad würde eine flexible Energiesteuer ausgleichen. Wäre der Marktpreis hoch, würde die Steuer niedriger sein, wäre der Marktpreis niedrig, wäre die Steuer höher. Für den Fall, dass der Marktpreis über dem Preispfad liegen würde, müsste für die Zeit, wo das so ist, der Staat den Unterschied durch Zuschüsse ausgleichen.
Auf den Einwand, dass Modelle dieser Art mit freier Marktwirtschaft nur schwer vereinbar seien, reagiert Schulmeister erstaunlich gelassen: „Ich erwarte, dass ähnliche Mechanismen kommen werden. Ich glaube, die Welt wird gerade in der aktuellen Krise merken, dass der Markt nicht alles regeln kann. Es war in der Geschichte schon immer so, dass bei Kriegen und Krisen Staaten immer planwirtschaftliche Elemente eingeführt haben – eben weil Planwirtschaft manche Probleme besser lösen kann als der Markt.“
Ob Schulmeister mit dieser Einschätzung recht hat oder nicht, bleibt offen. Doch allein die Tatsache, dass im Moment – vom Aussetzen der Mehrwertsteuer bis zu flächendeckenden Energiezuschüssen – gehäuft Lösungsvorschläge diskutiert werden, die wieder auf mehr Regulierung und staatliche Eingriffe abzielen, zeigt: Putins Krieg hat die Energiewelt tatsächlich auf den Kopf gestellt.
„Wir verdoppeln die Mittel zur Armutsbekämpfung!“
Als Spartenobmann verantwortet Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie, bei Oesterreichs Energie den Bereich Handel und Vertrieb. Darüber, was den Markt bewegt und wie sich die Preise der Zukunft entwickeln könnten, weiß er daher bestens Bescheid.
Was hat den Strompreis in den vergangenen Monaten in die Höhe getrieben: die Bestrebungen, auf nicht fossile Energieträger umzurüsten, oder die Weltpolitik?
Michael Strebl: Die Gründe für die steigenden Strompreise liegen derzeit vornehmlich im globalen geopolitischen Bereich. Der Umstieg auf erneuerbare Energieträger spielt dabei nur eine Nebenrolle. Das starke globale Wirtschaftswachstum und damit verbunden die steigende Nachfrage nach Gas haben bereits vergangenes Jahr zu steigenden Gaspreisen geführt. Über die Gaskraftwerke, die in der kalten Jahreszeit verstärkt laufen, wirken sich diese Preissteigerungen auch auf die Strompreise aus. Die aktuelle Situation in der Ukraine und Russland beeinflusst die Lage natürlich massiv und bringt weitere Unsicherheit und Volatilität von Angebot und Nachfrage mit sich. Bei all dem darf man den dringend notwendigen Ausbau der Erneuerbaren nicht aus den Augen verlieren. Die Investitionen in erneuerbare Technologien sind weiterzuverfolgen, nur sie können uns langfristig eine Unabhängigkeit von fossilen Lieferketten ermöglichen.
Wie beurteilen Sie die von der Regierung angestrebten Instrumente zur Entlastung der Haushalte im Bereich Energiekosten? Sind sie zielführend oder verschleppen sie bloß die dringend notwendige Energiewende?
Strebl: In der aktuellen Situation geht es weniger um die Finanzierung der Energiewende – bei den derzeitigen Marktpreisen wären viele Technologien auch ohne Förderungen marktfähig –, sondern darum, dass Energie für die Haushalte leistbar bleibt. Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung ist aus unserer Sicht ein guter erster Ansatz. Darüber hinaus haben auch die Energieunternehmen eine Reihe von freiwilligen Maßnahmen gesetzt, darunter die Verdoppelung der Mittel zur Bekämpfung von Energiearmut und ein Verzicht auf Strom- und Gasabschaltungen für soziale Härtefälle bis Ende Mai 2022 sowie die Fortsetzung der bewährten Kooperationen mit Sozialeinrichtungen und Hilfsorganisationen. Auch auf Landesebene werden weitere Unterstützungsmaßnahmen erfolgen.
Abseits der Preisdiskussion: Was können Verbraucher in der aktuellen Situation noch tun, um ihre Energiekosten zu reduzieren?
Strebl: Die aktuelle Marktsituation ist sowohl für Kunden als auch Lieferanten schwierig – und wird es in den kommenden Monaten wohl auch bleiben. Es ist also tatsächlich ein günstiger Zeitpunkt, um Effizienzpotenziale im eigenen Umfeld zu identifizieren und, wo möglich, zu heben. Hier können Kundinnen und Kunden selbst aktiv werden – und dabei denke ich weniger an kleinere Verhaltensänderungen, sondern vor allem an strukturelle Maßnahmen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Wir wissen, dass in diesen Bereichen in Österreich noch große Effizienzpotenziale liegen. Den kleinsten Preis und den kleinsten ökologischen Fußabdruck haben am Ende die Kilowattstunden, die gar nicht verbraucht werden müssen.

Weitere spannende Berichte zum Thema Energie finden Sie in der „StromLinie“. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins zur Energiewende finden Sie hier.
Kostenloses Abo – jetzt bestellen!
Wenn sie die „StromLinie“ künftig per Post erhalten möchten, können Sie unser Magazin auch kostenlos abonnieren.