Netzentgelte als Risiko für Stromerzeuger
Die Pläne der Bundesregierung bezüglich der Einspeisenetzentgelte für Stromproduzenten sind für deren Wettbewerbsfähigkeit alles andere als förderlich, zeigt eine Studie im Auftrag von Oesterreichs Energie.

Die geplante Vorgabe ist knapp formuliert: „Das Netznutzungsentgelt ist von Entnehmern und Einspeisern pro Zählpunkt zu entrichten“, lautet § 120 (2) des im Kommen befindlichen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Bedenken gegen diese Bestimmung äußerte nicht zuletzt Oesterreichs Energie. Und das hat gute Gründe, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens Aurora Energy Research im Auftrag des Elektrizitätswirtschaftsverbands, die seit kurzem vorliegt. Denn damit würde die Kostenbelastung für die Stromerzeuger massiv steigen und deren Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.
Laut den Bestimmungen des derzeitigen Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes (ElWOG) haben Einspeiser mit einer netzwirksamen Leistung von mindestens fünf Megawatt (MW) schon derzeit Netzverlustentgelt zu entrichten. Die Höhe dieses Entgelts liegt derzeit bei 3,04 Euro/Megawattstunde (MWh). Ferner haben solche Einspeiser Systemdienstleistungsentgelt in der Höhe von 0,88 Euro/MWh zu bezahlen. Mit dem ElWG sollen Einspeiser inklusive Speicher nun zusätzlich Netznutzungsentgelt entrichten. Details dazu finden sich im bis dato vorliegenden Entwurf nicht. Als Ziel der geplanten Vorschrift gibt die Bundesregierung sinngemäß an, die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten zu wollen.
Österreich hat den zweithöchsten Einspeiseranteil an den Übertragungsnetzentgelten und den dritthöchsten Einspeiseranteil an den Verteilnetzentgelten im europäischen Vergleich. In Summe ergibt die absolute Belastung der Einspeiser durch die Entgelte die zweithöchste in der EU.
Wie Aurora Research feststellt, sind Einspeiser in Österreich allerdings „bereits heute stärker durch Netzentgelte belastet als Einspeiser in Nachbarstaaten“. Erstens weise Österreich „den zweithöchsten Einspeiseranteil an den Übertragungsnetzentgelten und den dritthöchsten an den Verteilnetzentgelten im europäischen Vergleich auf“. Zweitens sei die absolute Belastung der Einspeiser durch die Übertragungsnetzentgelte ebenfalls die zweithöchste in der gesamten Europäischen Union. „In den meisten EU-Mitgliedsstaaten gibt es kein einspeisebezogenes Netzentgelt oder es macht einen geringeren Anteil am Gesamtaufkommen der Netzentgelte aus“, stellt Aurora Research klar.
Im Detail erläutert das Beratungsunternehmen, dass die aktuellen Netzentgelte für die Stromeinspeisung rund fünf Prozent des Preises für Baseload im Stromgroßhandel im Jahr 2024 entsprechen. Ferner kommen diese Entgelte etwa vier bis fünf Prozent der Erlöse der Betreiber von Windparks und Photovoltaikanlagen gleich, die diese aufgrund des Marktprämienmodells des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) erzielen. Bei Gas- und Dampfkraftwerken, die für die Versorgungssicherheit unverzichtbar sind, liegen die Netzentgelte den Berechnungen von Aurora Research zufolge „bei etwa fünf Prozent der aktuellen kurzfristigen Produktionskosten“. Zu einer besonders dramatischen Kostenbelastung führt laut dem Beratungsunternehmen „die Kombination aus Netzentgelten für Verbrauch und Einspeisung“, wie sie gerade bei Speichern schlagend wird. „Zusammengenommen machen die Netzentgelte bis zu einem Drittel des durchschnittlich realisierbaren täglichen Spreads auf dem Spotmarkt für Strom aus“, konstatiert Aurora Research.
Nachteile gegenüber Deutschland
Was das für die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Kraftwerksbetreiber im EU-Strombinnenmarkt bedeutet, erörtert das Beratungsunternehmen am Vergleich mit Deutschland: „Durch die Netzentgelte hat ein Kraftwerk in Österreich effektiv um fünf Prozent höhere Produktionskosten als ein vergleichbares Kraftwerk in Deutschland. Die österreichischen Einspeisenetzentgelte entsprechen umgerechnet einem Gaspreisaufschlag von 2,3 Euro/MWh relativ zum aktuellen Gaspreis, das heißt, sie sind äquivalent zu um acht Prozent höheren Brennstoffkosten.“ Zudem entspreche die Belastung mit Netzentgelten einem Wirkungsgradverlust von etwa drei Prozentpunkten. Damit werde beispielsweise ein älteres deutsches Kraftwerk mit 57 Prozent Effizienz gegenüber einem modernen österreichischen Kraftwerk mit 60 Prozent Effizienz auf dem Strommarkt konkurrenzfähig: „Dies verursacht eine ineffizientere Energienutzung, Mehrkosten und höhere Emissionen.“ Auch profitieren manche Kraftwerke in Deutschland laut Aurora Research „von Zahlungen für vermiedene Netzentgelte, was den Kostenvorteil im Einzelfall weiter erhöht“.
Siebenfache Kosten
Das Problem: Mit den geplanten Netznutzungsentgelten für Einspeiser auf Basis des ElWG könnte sich diese Situation noch erheblich verschlechtern, warnt das Beratungsunternehmen: „Je nach Ausgestaltung könnte das Gesamtnetzentgelt um +2,1 Euro/MWh, +4,2 Euro/MWh, +10,6 Euro/MWh oder +23,8 Euro/MWh steigen. Im Extremfall würde sich das Einspeisenetzentgelt mit +23,8 Euro/MWh fast versiebenfachen – von heute etwa vier Euro/MWh auf 28 Euro/MWh. Bereits bei einer 25-Prozent-Entlastung der Verbraucher müssten Einspeiser mehr als dreimal so hohe Entgelte tragen als derzeit (14,6 Euro/MWh gesamt).“
Durch die Netzentgelte hat ein Kraftwerk in Österreich effektiv um fünf Prozent höhere Produktionskosten als ein vergleichbares Kraftwerk in Deutschland. Die österreichischen Einspeisenetzentgelte entsprechen umgerechnet einem Gaspreisaufschlag von 2,3 Euro/MWh relativ zum aktuellen Gaspreis, das heißt, sie sind äquivalent zu um acht Prozent höheren Brennstoffkosten.
Damit aber würden Anreize für Investitionen in Stromerzeugungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien, GuD-Kraftwerke sowie Speicher in Frage gestellt. Bei einer Verschiebung von zehn Prozent der Netznutzungskosten von den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu den Einspeisern würde sich die relative Entgeltbelastung für Windkraft- sowie PV-Anlagen von 4,6 Prozent auf 9,3 Prozent der Erlöse auf der Grundlage des EAG in etwa verdoppeln. Bei GuD-Kraftwerken wiederum wäre mit einer Verdopplung der Belastung von fünf auf 10,2 Prozent der Produktionskosten zu rechnen. Für Batteriespeicher schließlich würde die ohnehin schon erhebliche Kostenlast um rund 120 Prozent auf mehr als 40 Prozent des durchschnittlichen realisierbaren Spreads im Großhandelsmarkt ansteigen.
Integration als Risiko
Zu berücksichtigen ist dabei die starke Integration Österreichs in den europäischen Strommarkt, die Wettbewerbsverzerrungen verstärkt. Im Jahr 2024 beliefen sich die Stromexporte auf etwa 26 Terawattstunden (TWh), was rund 31 Prozent der Erzeugung entspricht. Die Importe wiederum waren mit etwa 19 TWh zu beziffern, was einem Viertel des österreichischen Strombedarfs gleichkommt.
Zwar hat beispielsweise Schweden laut Aurora Research „einen höheren Einspeiseranteil an den Netzentgelten als Österreich“. Doch werden in den meisten Nachbarländern „ebenfalls einspeiserseitige Netzentgelte erhoben“, was Wettbewerbsnachteile verringert. Auch korreliert die Stromerzeugung in Schweden kaum mit jener in den Nachbarländern. Meist stehen schwedische Anlagen im Wettbewerb mit teureren ausländischen Kraftwerken. Damit fallen die Netzentgelte für die Erzeuger anders als in Österreich kaum nachteilig ins Gewicht.
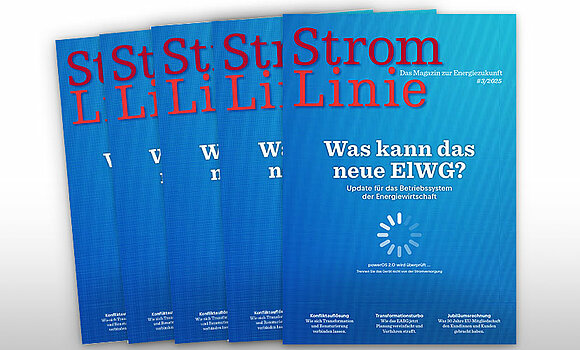
Weitere spannende Berichte zum Thema Energie finden Sie in der „StromLinie“. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins zur Energiewende finden Sie hier.
Kostenloses Abo – jetzt bestellen!
Wenn sie die „StromLinie“ künftig per Post erhalten möchten, können Sie unser Magazin auch kostenlos abonnieren.


