ElWG: Update für das Betriebssystem der Energiewirtschaft
Mit dem Anfang Juli veröffentlichten Begutachtungsentwurf zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) soll die seit Langem fällige Neuordnung des Sektors Gestalt annehmen. Doch was ist im Entwurf gut gelungen und wo bedarf es einer Nachschärfung?

Die Freude darüber, dass das Elektrizitätswirtschaftsgesetz nach jahrelangen Ankündigungen, Rückziehern und neuerlichen Anläufen in die Zielgerade einbiegt, ist auch bei Barbara Schmidt, der Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, spürbar: „Auch wenn es derzeit intensive Debatten gibt und auch wir unsere Kritik geäußert haben: Der vorliegende Entwurf des ElWG ist über weite Strecken gut und zielführend. Er enthält viele richtige Ansätze und wichtige Maßnahmen, um unser Stromsystem zukunftsfit zu machen“, merkte sie am Ende der Begutachtungsfrist an.

Lob …
Viele Elemente, die im aktuellen Entwurf verankert sind, finden in der Branche Zustimmung. So gilt etwa die vorgesehene Flexibilisierung der Netztarife als ein wichtiges Instrument, um netzdienliches Verhalten zu fördern. Auch die Möglichkeit, Spitzen bei Photovoltaik- und Windkraftanlagen gezielt zu kappen, haben die Branchenvertreter schon lange gefordert und sehen es daher als positiv an, dass dies nun im Gesetz verankert werden soll. „Solche Elemente setzen wichtige Impulse für
Effizienz und mehr Systemdienlichkeit“, sagt Schmidt.
… und Tadel
An anderen Teilen des Entwurfs übt Strugl allerdings deutliche Kritik. Der Plan, Erzeuger stärker an den Netztarifen zu beteiligen, ist in seinen Augen ein gravierender Rückschritt, weil Investitionen in Erneuerbare Energien dadurch unattraktiver werden. Wird diese Idee beibehalten, würde Österreich ins Hintertreffen geraten: „Netzentgelte für Erzeuger bestrafen genau jene, die mit ihren Investitionen die Grundlage für die wettbewerbsfähige und sichere Stromversorgung von morgen schaffen“, betont Strugl.
Als eine kontraproduktive Regelung sieht die Energiewirtschaft auch die vorgesehenen Regelungen zu einem Sozialtarif. Das Vorhaben, einkommensschwache Haushalte zu entlasten, ist zwar durchaus sinnvoll, könne aber nicht den Energielieferanten überantwortet werden, fasst Barbara Schmidt die Position der Branche zusammen: „Die E-Wirtschaft ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und hat langjährige Partnerschaften mit Hilfsorganisationen und Sozialeinrichtungen. Energiepolitik ist aber kein probates Mittel zur Lösung sozialer Fragen.“

Verbesserungspotential
Verbesserungspotential ortet die Energiewirtschaft auch beim Thema Preisanpassungsrecht. Grundsätzlich begrüßt die Branche zwar, dass der Entwurf Rechtssicherheit schaffen will. Doch die vorgesehene Pflicht, nach jeder Preiserhöhung binnen sechs Monaten eine Senkung vorzunehmen, falls die Marktbedingungen es zulassen, wird als völlig praxisfern kritisiert. Sie widerspreche den langfristigen Beschaffungsmechanismen und gefährde stabile Fixpreisangebote. „Für einen lebendigen Wettbewerb am Strommarkt brauchen wir Wahlfreiheit der Kunden und keine gesetzliche Pflicht zum Halbjahresvertrag“, fasst Oesterreichs Energie Präsident Strugl die Kritik zusammen.
Gut gemeint, aber in der jetzigen Form noch nicht gut gemacht, ist die Befreiung der Speicher von doppelten Netzentgelten. „Der Gesetzesentwurf versucht, die entscheidende Rolle der Energiespeicher bei der Bereitstellung der für die Transformation des Energiesystems notwendigen Flexibilität zu berücksichtigen und stellt systemdienliche Speicher daher von wesentlichen Netzentgelten frei. Allerdings wird der Begriff der Systemdienlichkeit zu eng definiert und der Entwurf gibt keine klaren Regeln vor, um auch den marktbasierten systemdienlichen Betrieb von Speichern von Netzentgelten freizustellen“, so Schmidt.
Ebenso auf Skepsis stößt die geplante komplexe Abwicklung der neuen Auffangversorgung, die Kundinnen und Kunden nach Vertragsende automatisch einem Versorger zuteilt. Für die Energieversorger würde sie unkalkulierbare Mengen- und Preisrisiken sowie erheblichen administrativen Aufwand bedeuten.
Verursachergerechtigkeit
Bedenken äußert man auch gegen sogenannte geschlossene Verteilernetze, etwa innerhalb von großen Wohnanlagen oder Industrieparks. Damit optimieren sich Einzelne auf Kosten der Mehrheit. Ähnlich kritisch sieht man auch die angedachten zusätzlichen Risiko-Berichtspflichten für die Energieversorger. Sie würden, so heißt es, hohe Kosten verursachen, ohne real die Versorgungssicherheit zu erhöhen.
Zudem machen Vertreter der Energiewirtschaft auf ein ihrer Ansicht nach fragwürdiges grundsätzliches Muster aufmerksam, das den Entwurf prägt: Kosten und Risiken werden zu oft auf die etablierten Energieunternehmen und ihre Kundinnen und Kunden abgewälzt. Damit werde nicht nur die Verursachergerechtigkeit infrage gestellt, sondern auch die Investitionssicherheit für die notwendige Transformation des Stromsystems geschwächt.
Rot-weiß-roter Schulterschluss
Oesterreichs Energie stellt dazu in einer Stellungnahme fest: „Die E-Wirtschaft steht der Einführung neuer Marktrollen grundsätzlich positiv gegenüber, doch darf dies nicht zu einer einseitigen Risiko- und Kostenüberwälzung auf die derzeitigen Lieferanten erfolgen. Eine derartige Überwälzung energiewirtschaftlicher Mengen sowie Preisrisiken – etwa durch Peer-to-Peer-Verträge, Eigenversorger oder Energiegemeinschaften – ist sachlich nicht gerechtfertigt.“
Zudem betonen Vertreterinnen und Vertreter von Oesterreichs Energie, dass es angesichts der mehr als herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Lage darauf ankomme, Partikularinteressen hintanzustellen. „Das ElWG ist eine wichtige Grundlage für die Transformation des Energiesystems in den kommenden Jahren und Dekaden. Anstelle von Einzelinteressen brauchen wir im Interesse der Wirtschaft und des Standortes einen rot-weiß-roten Schulterschluss, der die Kosten und Wechselwirkungen im gesamten Stromsystem im Blick behält“, betont daher Oesterreichs Energie Präsident Michael Strugl.
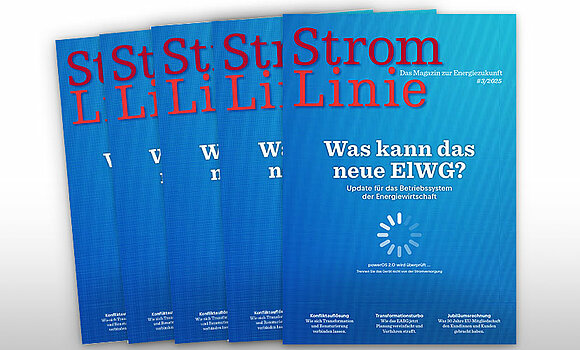
Weitere spannende Berichte zum Thema Energie finden Sie in der „StromLinie“. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins zur Energiewende finden Sie hier.
Kostenloses Abo – jetzt bestellen!
Wenn sie die „StromLinie“ künftig per Post erhalten möchten, können Sie unser Magazin auch kostenlos abonniere


