Ausbau vs. Naturschutz: EU-Regeln im Zielkonflikt
Transformation und Renaturierung: Zwischen den Anforderungen der Erneuerbaren-Richtlinie und jenen der Wiederherstellungsverordnung der EU bestehen Widersprüche, die für Betreiber von Infrastrukturprojekten schwer zu überbrücken sind. Wiener Rechtsanwälte entwickelten jetzt eine Lösung.
Das Problem ist seit längerem bekannt: Einerseits existiert auf der Ebene der EU eine Reihe von Rechtsakten, um Infrastrukturvorhaben in unterschiedlichen Bereichen beschleunigt umsetzen zu können. Dazu gehören etwa die TEN-E-Verordnung im Bereich der transeuropäischen Netzinfrastruktur, die TEN-V-Verordnung für die Verkehrsinfrastruktur sowie die „Erneuerbaren-Richtlinie“ (RED III) zum Ausbau der Stromproduktion mithilfe Erneuerbarer Energien.

Andererseits bestehen Regelungen, die der Verbesserung von Natur- und Umweltschutz dienen sollen, darunter die Wasserrahmenrichtlinie sowie seit 2024 die sogenannte „Wiederherstellungsverordnung“ zum Zweck der Renaturierung bestimmter Lebensraumtypen. „Diese Bestimmungen stehen naturgemäß in einem gewissen Konflikt zueinander“, erläutert Christian Schmelz, Partner bei Schoenherr Rechtsanwälte in Wien: „Man wird schwer in einem Gebiet einen Windpark errichten können, wenn man dort Flächen für den Vogelschutz herstellen möchte.“
Besonders virulent ist diese Problematik derzeit bei den widersprüchlichen Vorgaben der RED III und der Wiederherstellungsverordnung, die beide binnen der kommenden Jahre umgesetzt werden müssen. Bereits bis 21. Feber 2026 sind auf Basis der RED III die sogenannten „Beschleunigungsgebiete“ für den zügigeren Ausbau von Windparks und Solaranlagen festzulegen.
Bis 1. September 2026 wiederum haben die EU-Mitgliedsstaaten der EU-Kommission die Entwürfe ihrer „nationalen Wiederherstellungspläne“ zu übermitteln, die sich auf Gebiete zur Wiederherstellung von Lebensraumtypen nach Art der bekannten Natura-2000-Gebiete beziehen. Zu der Herausforderung, dass sich in der verbleibenden Zeit kaum fachlich fundiert feststellen lässt, welche Gebiete wie wiederherzustellen sind und welche Lebensraumtypen welche Defizite aufweisen, kommen die auf Bund und Länder verteilten Kompetenzen.
Ein koordiniertes Vorgehen der Gebietskörperschaften ist daher dringend geboten. Andernfalls trifft die Problematik die Unternehmen, die Infrastrukturprojekte umsetzen möchten, warnt Schmelz: „Wenn jemand beispielsweise einen Windpark errichten möchte, muss er sich fragen, ob das betreffende Gebiet nicht eigentlich für die Wiederherstellung vorgesehen sein sollte.“ Überdies sind die Projektbetreiber damit konfrontiert, sich Flächen für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die Umweltauswirkungen ihrer Vorhaben sichern zu müssen. Deren Verfügbarkeit nimmt aber mit der zunehmenden Wiederherstellung von Lebensräumen gemäß der Wiederherstellungsverordnung tendenziell ab. Und Renaturierungen, die wegen dieser Verordnung oder anderer Bestimmungen ohnehin erfolgen müssen, werden nach gängiger Praxis von den Genehmigungsbehörden nicht als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt.
Koordinierung nötig
Für diese Problematik erarbeiteten Schmelz und sein Kollege Christoph Jirak mögliche Lösungen. Sie bestehen in einem ersten Schritt im Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a des Bundes-Verfassungsgesetzes. Mit der Vereinbarung würde ein Planungsausschuss etabliert, der die koordinierte Umsetzung der RED III und der Wiederherstellungsverordnung sowie allfälliger weiterer Planungen gewährleistet und damit die Projektwerber und die Behörden vor den Problemen einander widersprechender Planungen bewahrt. Laut Jirak sind die Länder ohnehin gezwungen, sich ins Einvernehmen zu setzen, weil sich Lebensraumtypen oft genug über ihre Grenzen hinweg erstrecken, manchmal auch über die Grenzen des Bundesgebiets hinaus. Folglich liegt nahe, in einem Zuge festzulegen, in welchen Gebieten welche Arten von Infrastrukturprojekten möglich sind.
Ferner ließe sich auch die Frage der Finanzierung der Wiederherstellungen lösen. Bis dato profitieren Kommunen davon, wenn sich in von ihnen festgelegten Industrie- sowie Gewerbegebieten Betriebe ansiedeln. Renaturierungen rechnen sich demgegenüber für sie nicht und sind daher wirtschaftlich unattraktiv. Die für die Wiederherstellung der Natur primär zuständigen Länder haben dem Bund im Wege der Landeshauptleutekonferenz bereits ausgerichtet, dass sie die erheblichen Kosten zur Wiederherstellung der Natur nicht stemmen können. Dem lässt sich entgegenwirken, indem die Projektwerber die Renaturierungen bezahlen – freilich unter der Voraussetzung, dass ihnen diese zumindest in einem gewissen Umfang als Ausgleichsmaßnahmen in den Projektgenehmigungsverfahren angerechnet werden.
Als sinnvoll könnte sich dabei erweisen, aufgrund der zwischen den Ländern untereinander sowie mit dem Bund abgestimmten Planung Gebiete für Ausgleichsmaßnahmen in Flächenpools zu bündeln. Maßnahmen, die dort gesetzt werden, könnten von Projektwerbern finanziert und ihnen entsprechend angerechnet werden – eventuell auch auf künftige Vorhaben.
Hilfreich wäre Jirak zufolge, den bisher vorgeschriebenen engen räumlichen sowie funktionalen Zusammenhang zwischen einem Projekt und den dafür nötigen Ausgleichsmaßnahmen zu lockern. Dies würde ermöglichen, ökologische Ausgleichsmaßnahmen dort zu setzen, wo sie besonders wirksam sind. Laut Schmelz ergäbe sich damit eine „Win-Win-Situation: Die Projektwerber können ihre Projekte umsetzen, indem sie Ausgleichsmaßnahmen durchführen oder finanzieren, die ökologisch in großem Maßstab wirksam sind. So lassen sich sowohl die Ausbau- als auch die Renaturierungsziele sehr effizient erreichen“.
Effiziente Methode
In letzter Konsequenz könnte sich nach Ansicht Schmelz’ und Jiraks sinnvoll erweisen, in Österreich sogenannte „Ökokonten“ einzuführen, wie sie in Deutschland bereits bestehen. In Deutschland können Unternehmen, die sich auf Renaturierungen spezialisiert haben, entsprechende Projekte durchführen. Sie erhalten dafür auf entsprechenden Konten Ökopunkte gutgeschrieben, die sie an Infrastrukturunternehmen verkaufen können. Diese wiederum haben die Möglichkeit, die Ökopunkte in den Genehmigungsverfahren zum Ausgleich der Umweltauswirkungen von ihnen umgesetzten Vorhaben zu verwenden. Der Handel der Punkte erfolgt mittlerweile auch über einschlägige Börsen.
Der Vorteil dieses Systems ist offensichtlich: Spezialisten setzen Renaturierungsmaßnahmen so, dass diese mit geringstmöglichem Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzielen. Die Infrastrukturunternehmen wiederum brauchen im Zuge der Genehmigungsverfahren keine Ausgleichsmaßnahmen mehr zu entwickeln: Sie legen der Behörde einfach die von dieser vorgeschriebene Anzahl von Ökopunkten vor. „Naturschutz und Renaturierung kosten nun einmal Geld. Das Ökokontensystem ist eine marktwirtschaftliche Methode, um die entsprechenden Ziele möglichst effizient zu erreichen“, resümiert Schmelz.
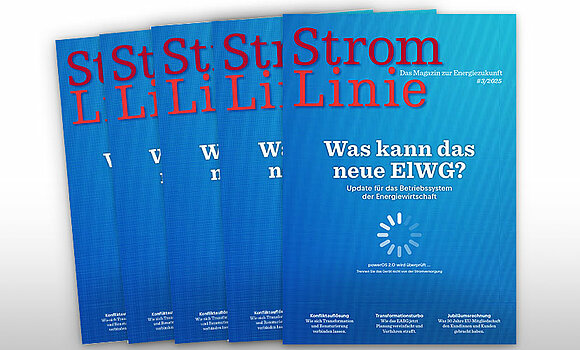
Weitere spannende Berichte zum Thema Energie finden Sie in der „StromLinie“. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins zur Energiewende finden Sie hier.
Kostenloses Abo – jetzt bestellen!
Wenn sie die „StromLinie“ künftig per Post erhalten möchten, können Sie unser Magazin auch kostenlos abonnieren.


