30 Jahre EU-Beitritt: Was hat die Liberalisierung der Energiemärkte gebracht?
Die Diskussion um Energiepreise hat die nächste Erregungsstufe erreicht. Forderungen nach Regulierung und mehr staatlicher Kontrolle werden lauter.
Am weitesten lehnte sich das Momentum-Institut aus dem Fenster: „Strommarktliberalisierung für Haushalte rückgängig machen“, forderte Mitte August der gewerkschaftsnahe Think Tank. Nebenher machte man sich auch für eine Verstaatlichung der Gaskraftwerke und die Umgründung von VERBUND in eine Genossenschaft stark. Doch auch so manche Idee im aktuellen Entwurf zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz, etwa garantierte Sozialpreise, zeigt: Das Vertrauen in den Markt war schon einmal größer.

Walter Boltz, der erste Chef der E-Control und bei der Strommarktliberalisierung als Pionier dabei, kann sich noch gut an jene Zeit erinnern, als der Energiesektor in Europa streng reguliert und Marktprinzipien de facto ausgesetzt waren: „Der Markt steckte in einer sklerotischen Monopolstruktur mit viel zu hohen Produktions- und Personalkosten. Die Idee der Liberalisierung kam damals unter anderem auch deshalb auf, weil die Strom- und Gaspreise in Europa deutlich höher waren als in den USA oder Japan.“
Lächerliche Vorstellung
Heute, sagt Boltz, wollen manche Player in einer ähnlichen Situation das Problem dadurch lösen, dass sie die Liberalisierung wieder rückgängig machen. „Doch die Annahme, Verstaatlichung bringe automatisch billigeren Strom, ist lächerlich, gerade, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft“, urteilt er.
Dass die Liberalisierung den Strom verbilligt und nicht verteuert hat, ist inzwischen empirisch gut belegt. In der Studie „Volkswirtschaftliche Effekte der Energiemarktliberalisierung“ der Österreichischen Energieagentur zeigen die Autoren, dass sich österreichische Haushalte und Unternehmen durch die Strommarktliberalisierung bis 2019 mehr als 13 Milliarden Euro erspart haben. Ohne die Liberalisierung wären der Studie nach die Strompreise für Haushalte um rund 13 Prozent und für Unternehmen um rund 10 Prozent höher. Da gleichzeitig mit der Strommarktliberalisierung auch der Gasmarkt liberalisiert wurde, betrug die tatsächliche Ersparnis über alle Energieträger hinweg aber deutlich mehr, nämlich 28 Milliarden Euro.
Gut für die Volkswirtschaft
Rechnet man preisdämpfende Effekte aus Deutschland hinzu, die es ohne die Strommarktliberalisierung nicht gegeben hätte, die aber zumindest bis 2018 stark auf den österreichischen Markt durchschlugen, beträgt der kumulierte Kostenvorteil der Strommarktliberalisierung sogar 49 Milliarden Euro.

Die Liberalisierung hatte aber nicht nur bezüglich der Energiekosten handfeste positive Auswirkungen auf die österreichische Volkswirtschaft: Nach den konservativen Berechnungen der Österreichischen Energieagentur wäre das österreichische BIP ohne die Strommarktliberalisierung pro Jahr um 0,4 Prozent weniger stark gestiegen bzw. es wäre in Jahren mit negativer BIP-Entwicklung zu noch stärkeren BIP-Rückgängen gekommen.
Angesichts dieser Tatsachen, sagt die NEOS-Europaabgeordnete und Mitglied im für Energie zuständigen ITRE-Ausschuss Anna Stürgkh, ist die manchmal in den Raum gestellte Behauptung, die Liberalisierung des Strommarkts sei einer der großen Fehler der EU gewesen, völlig absurd: „Es kann kaum in Abrede gestellt werden, dass die Liberalisierung in den vergangenen zwanzig Jahren große Vorteile gehabt hat, sowohl für Konsumentinnen und Konsumenten als auch für die Wirtschaft.“
Mehr Markt, nicht weniger
Die Antwort in der heutigen anspruchsvollen Situation müsse daher lauten: mehr Liberalisierung statt weniger. „Wir brauchen keine Demontage des Marktes, sondern ganz im Gegenteil seine konsequente Weiterentwicklung. Eine Stärkung des Wettbewerbsrechts und eine Entflechtung der gegenseitigen Beteiligungen vieler Stromversorger wären aus meiner Sicht dringend nötig.“
Beide Aspekte greift auch die Task-Force von E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde in ihrem Endbericht auf. Aus Sicht der E-Wirtschaft sollten bestehende Regelungen zwar auf ihre Tauglichkeit überprüft werden, neue und zusätzliche staatliche Eingriffe jedoch vermieden werden.
Zumindest teilweise sieht Stürgkh die Verantwortung aber auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten selbst. Denn während anderswo private Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen ihre Strompreise sehr genau verfolgen und gegebenenfalls nach neuen Lieferanten suchen, seien Österreicherinnen und Österreicher immer noch, wie Stürgkh es formuliert, „wechselfaul“.
Die Statistik bestätigt das: Trotz der lauten Klagen über hohe Energiekosten hat Österreich 2024 nach Angaben der E-Control eine Wechselquote von 4,7 Prozent jährlich. Mehr als die Hälfte hat noch nie den Anbieter gewechselt. Der EU-Schnitt liegt laut der europäischen Energieregulierungsbehörde CEER und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden ACER bei 7,5 Prozent. In besonders wechselfreudigen Ländern wie zum Beispiel Estland sind es bei Privatkund:innen sogar an die 20 Prozent und im Unternehmensbereich mehr als 30 Prozent.
Ungenutzte Hebel
Dabei ist die Möglichkeit, den Stromanbieter zu wechseln, einer der größten Hebel, die Nutzerinnen und Nutzer haben, um auch in kritischen Zeiten nicht mehr zahlen zu müssen als nötig, wie E-Control-Vorstand Alfons Haber betont: „Heute können Haushaltskundinnen und -kunden aus mehr als hundert unterschiedlichen Angeboten für den Stromliefervertrag wählen. Die Möglichkeit des Wettbewerbs erhöht den Druck auf die Lieferanten, Preise und Servicequalität zu verbessern.“ Die Liberalisierung, sagt er, habe aber auch eine massive Verbesserung der Versorgungssicherheit mit sich gebracht.

Auch Paul Rübig, einer der längstgedienten Europa-Parlamentarier und ein Abgeordneter, der die Strommarktliberalisierung mitgestaltet hat, betont diesen Punkt, denn Versorgungssicherheit sei eine der Kernaufgaben des Energiesystems. Gerade deshalb warnt Rübig, der heute Mitglied des Verwaltungsrats von ACER und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses EWSA ist, davor, Maßnahmen wie Verstaatlichung oder Übergewinnbesteuerung zu propagieren. „Letztlich sind es nur der Wettbewerb und die Entscheidung der Konsumenten, die zu effizienten Systemen führen. Alles andere ist ideologiegeprägt und Ideologie schafft keine Werte. Im Gegenteil: Sie macht Energie teuer und gefährdet auch die Versorgungssicherheit.“
Um die für eine sichere Versorgung notwendigen Investitionen zu schaffen, darunter den zügigen Ausbau der Netze und der Flexibilitäten, empfiehlt Rübig, vor allem unnötige bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen. „Wenn wir uns darauf verständigen, dass Genehmigungsverfahren innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein müssen, sei es positiv, sei es negativ, wäre das ein idealer Anschub.“
Dass der Staat hingegen direkt dort übernimmt, wo es um große Infrastrukturprojekte wie den Netzausbau geht, hält Rübig für falsch. Es gebe genug privates Kapital, das für diese Aufgabe aktiviert werden kann, meint er und empfiehlt daher transparente Public-Private-Partnership-Modelle. „Die Rolle des Staates sollte es sein, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zu schaffen, statt durch Eingriffe in den Markt Möglichkeiten zu verhindern.“
In der Branche ist man sich einig, dass die Netzkosten gedämpft werden müssen. Zahlreiche Expertinnen und Experten arbeiten daher derzeit an Konzepten, wie sich die Kosten des Netzausbaus begrenzen und Finanzierungsoptionen sichern lassen – ohne die Versorgungssicherheit oder Österreichs Souveränität im Bereich dieser kritischen Infrastruktur zu gefährden.
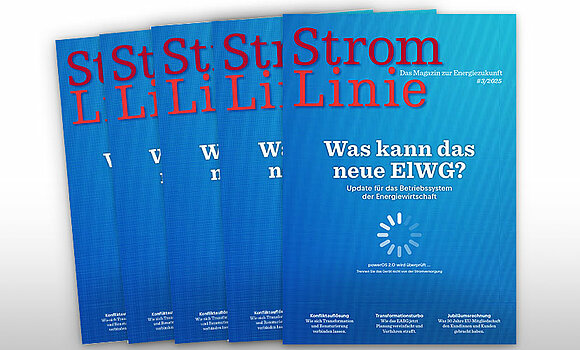
Weitere spannende Berichte zum Thema Energie finden Sie in der „StromLinie“. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins zur Energiewende finden Sie hier.
Kostenloses Abo – jetzt bestellen!
Wenn sie die „StromLinie“ künftig per Post erhalten möchten, können Sie unser Magazin auch kostenlos abonnieren.




